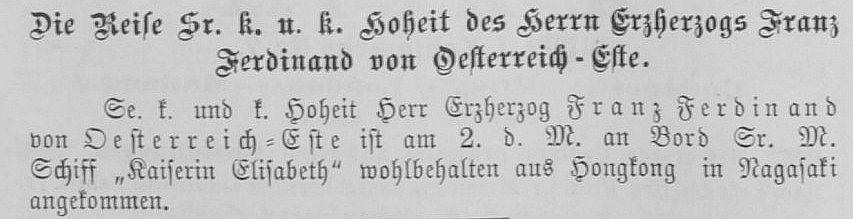Dichter, bis zum Meeresspiegel niedergehender Nebel verwehrte jeden Ausblick und obendrein strömte unaufhörlicher Regen herab. Jupiter Pluvius, der mich während der Reise schon einige Mal verfolgt hatte, schien auch hier nicht aus der Rolle fallen zu wollen. Dass aber der launische Wettergott gerade heute des Himmels Schleusen öffnete, nahm ich ihm um so mehr übel, als innerhalb der letzten sechs Wochen kein Tropfen über der Landschaft gefallen war, so dass die Einwohner bereits Bittgänge veranstaltet hatten, um bei den Göttern Hilfe durch reichlichen Regen für die aufs höchste gefährdete Reisernte zu erflehen. Konnte die Erfüllung dieser Bitte nicht schon früher gewährt werden, so wäre mir ein kleiner Aufschub erwünscht gewesen.
Immerhin hätte mich die Unbill des Wetters nicht gehindert, Nagasaki vormittags zu besuchen, wenn nicht ein Platzregen von Audienzen und Aufwartungen zu bestehen gewesen wäre.
Kaum war mit dem Flaggenschuss die Standarte gehisst worden, so widerhallte der Hafen von dem Donner der Geschütze der hier ankernden Kriegsschiffe, deren jedes mit 21 Schüssen den Salut leistete, ein Ehrengruß, der auf mich immer eine ungemein erhebende Wirkung hervorbringt, da er ja unserer Standarte gilt.
Unmittelbar nach dieser Begrüßung wurde unser Fallreep durch eine Flotille von Barkassen und Booten belagert, welchen in schier endloser Reihe Dignitäre entstiegen: Admirale und Schiffskommandanten; der Gouverneur des Kens (Departements) Nagasaki, Takeaki Nakano; der Bischof und apostolische Vikar J. A. Cousin; der Bürgermeister von Nagasaki; die Mitglieder des Konsularkorps und die mir zugeteilte japanische Suite. Diese besteht aus dem Vize-Großmeister des kaiserlichen Zeremonienamtes (Schikibu Schiki), Yoschitane Sannomija, welchem in der Regel die Leitung von Reisen, wie jener, die ich unternehme, zufällt; ferner aus dem Küchenmeister (Meister der kaiserlichen Küche, Daisen Schiki) K. Jamanoutschi; endlich aus dem Linienschiffskapitän Kurvaka und dem Geheimsekretär des Kriegsministers, Major
M. Muraki. Die erschienenen Herren waren teils der deutschen, teils der französischen Sprache mächtig; drei derselben hatten Europa bereist und insbesondere auch Wien besucht, um den Haushalt und das Zeremoniell unseres Hofes zu studieren.
Nachdem das Gewimmel der Dignitäre im Laufe des Nachmittages ein Ende genommen, fuhr ich ans Land, Nagasaki zu besuchen. Zum ersten Mal betrat ich japanischen Boden und fand mich, obschon die Stadt nicht mehr rein japanischen Charakter trägt, sondern mannigfache Wirkungen europäischen Einflusses zeigt, alsbald von all jenen zur Wirklichkeit gewordenen zierlichen, bunten, lebhaften Szenen umgeben, welche den Inhalt unserer Vorstellung vom japanischen Leben ausmachen, die wir aus Büchern schöpfen und durch Darstellungen auf künstlerischen sowie industriellen Erzeugnissen bereichern.
Die engen und, weil die kleinen Häuser selten mehr denn ein Stockwerk tragen, doch luftigen, lichten Straßen entlang schlendernd, trieben wir „fensterlnd“ praktische Ethnographie. Die aus Holz und Papier erbauten Behausungen gestatten Einblick nicht nur in die Wohnräume der Japaner, sondern auch in deren daselbst sich abspielendes Leben; denn der Abschluss der Häuser gegen die Straße wird meist nur durch verschiebbare Wände gebildet, die tagsüber oft entfernt sind, so dass das ganze Innere sich den Blicken der Vorbeieilenden darbietet. Auch die Abteilung der Innenräume ist mittels hölzerner, mit Papier überspannter, häufig kunstvoll bemalter Wände gebildet, welche nach Bedarf ausgehoben und verschoben werden können.
Ein japanisches Häuschen hat daher die Fähigkeit, sich den räumlichen Bedürfnissen seiner Bewohner in einer Weise anzupassen, welche uns, die wir an die starren, unverrückbaren Mauern unserer Bauwerke gewöhnt sind, in höchstes Erstaunen setzt und in dem japanischen Wohnhaus kein „unbewegliches Gut“ in heimatlichem Sinn erblicken lässt. Was wir an Hausrat ersehen, bewegt sich in den bescheidensten Grenzen; mit Ausnahme einiger Geräte für den allernotwendigsten Gebrauch, wird jener hauptsächlich durch schöne, hellgelbe Strohmatten gebildet, welche den Fußboden aller Wohnräume bedecken. Um so mannigfaltiger sind all die gewerblichen Arbeiten, die sich in den Werkstätten und Verkaufsläden vollziehen und als Belege der Emsigkeit, des Kunstsinnes der Japaner wohltuende Wirkung hervorbringen.
In den Straßen immer weiterschreitend, waren wir Zeugen häuslicher Verrichtungen, wie sie das Alltagsleben des japanischen Volkes mit sich bringt, aber auch manche anmutige Familienszene spielte sich vor uns ab, und nicht wenige Söhne und Töchter Nippons konnten wir bei allerlei Phasen des intimen Lebens beobachten. Während nach unseren heimatlichen Sitten und Gebräuchen zwischen der Häuslichkeit und der Öffentlichkeit eine scharfe Grenze dort gezogen ist, wo die Türe geräuschvoll in das Schloss fällt, besteht hier eine ähnliche Scheidung nicht; denn das Leben im Haus, welches so offen vor uns daliegt, geht unmerklich in jenes auf der Straße über und umgekehrt scheint letzteres unbehindert in die Behausungen zu fluten.
Wo immer wir auch hinblickten, begegnete uns Reinlichkeit und Nettigkeit in wohltuendem Gegensatz zu der für das Chinesentum charakteristischen Unsauberkeit.
Die abendländische Kultur, welche sich in Nippon in überraschend kurzer Zeit Bahn gebrochen, kommt auch schon in der Kleidung zum Ausdruck, nicht eben zum Vorteil der Japaner, deren Gestalten und Formen für die europäische Tracht kaum geeignet sind. Die höheren Schichten der japanischen Gesellschaft bedienen sich fast ausschließlich europäischer Kleidung, welche für die Hofkreise und die Beamten geradezu vorgeschrieben ist, während die Masse des Volkes an der altgewohnten, durch Generationen ererbten Art, sich zu kleiden, noch festhält, obschon auch in den unteren Klassen bald dieses, bald jenes Zugeständnis an die neue Mode gemacht und so in die Landessitte eine Bresche um die andere gelegt wird. Als ausgesprochener Freund jeglicher Nationaltracht beklage ich die Verdrängung des so kleidsamen japanischen Kostüms durch unsere nivellierende, charakterlose Kleidung. So mancher Japaner, der sich in landesüblicher Gewandung recht gut präsentieren würde, wirkt befremdlich, um nicht zu sagen erheiternd, wenn er, mit langem Gehrock angetan und mit hohem Zylinder geschmückt, gravitätisch einherschreitet oder sich unaufhörlich verneigt.
Männlein und Weiblein eilen an uns vorbei, und zwar, soweit sie der Landessitte treu geblieben sind, immer fächelnd, auf Sandalen und Holzstöckelschuhen (Getas) einhertrippelnd und klappernd. Die Männer schienen mir, von einzelnen sympathischen und beinahe wohlgestalteten Erscheinungen abgesehen, im Durchschnitt unschön zu sein; in den Gesichtszügen finden sich die Merkmale der mongolischen Rasse scharf ausgeprägt, die Körperhöhe ist eine geringe, und die Beine sind auffallend häufig säbelförmig verkrümmt.
In Vergleichung mit den Männern ist der weibliche Teil der Bevölkerung fast hübsch oder, genauer gesprochen, äußerst zierlich zu nennen; alle Japanerinnen, welche wir zu sehen bekamen, zeigten den gleichen Typus und machten, während sie lächelnd und scherzend die Straßen entlang trippelten, den Eindruck lebendig gewordener, allerliebster Porzellanfigürchen.
Ab und zu begegneten wir einem Mädchen mit auffallend regelmäßiger, schöner Physiognomie, welche, selbst mit den Gesichtszügen europäischer Beautés verglichen, volle Anerkennung gefunden hätte; doch war mir schon bei der Wanderung durch Nagasaki die Möglichkeit geboten, mein Urteil dahin zu bilden, dass in so mancher Reisebeschreibung, die ich gelesen, in so mancher Mitteilung, welche ich erhalten, Japans Weiblichkeit über die Gebühr gepriesen wird, wenn die Mädchen dieses Himmelsstriches als die schönsten Töchter Evas geschildert werden.
Solches Lob dürfte doch nur auf Rechnung ganz individueller Geschmacksrichtung und besonderer Motive zu setzen sein. Die anmutige Wirkung der stets Heiterkeit atmenden Mädchengestalten liegt in der harmonischen Nettigkeit und Zierlichkeit der Erscheinungen, die aber dem europäischen Schönheitssinn doch zu puppenhaft dünken, um darauf Anspruch erheben zu können, einen idealen weiblichen Typus darzustellen. Leider verwelkt die Jugendfrische der Japanerin sehr rasch, so dass nur selten eine hübsche Frau zu sehen ist, wozu wohl auch die uns unbegreifliche Sitte beiträgt, dass Frauen ihre Zähne schwarz färben und die Augenbrauen abrasieren — entstellende Gebräuche, welche in den höheren Schichten der Gesellschaft allerdings kaum mehr vorkommen sollen, aber in den unteren Klassen noch immer üblich sind.
Obschon Japans Frauen durch die Volksanschauung zum Teil auch heute gezwungen sind, ihr Äußeres dem Ehegatten zum Opfer zu bringen, gehen die Damen hierin doch nicht weiter, als unbedingt notwendig erscheint; denn jede Japanerin, ob Frau ob Mädchen, wendet ihrer Kleidung und Haartracht besondere Sorgfalt zu. Wir hatten Gelegenheit, hierin Erfahrungen zu sammeln, da wir Zeugen waren, wie so manche Schöne Toilette machte; und nicht etwa nur in verstohlener Weise durften wir dies Schauspiel genießen, sondern frank und frei, von der Straße aus in das Boudoir blickend, machten wir Bekanntschaft mit den intimsten Geheimnissen der Künste, durch welche die Japanerin zu bestricken weiß. Unsere Neugierde ward uns übrigens gar nicht übel genommen, und keine der zierlichen Papierwände wurde vorgeschoben, um Schutz vor den Blicken Unberufener zu gewähren, ja ganz im Gegenteil, die belauschten Damen winkten uns freundlich zu oder brachen gar in helles Lachen aus, wenn sie unseres Erstaunens über die ungeahnte Freiheit der Sitten gewahr wurden.
Den kompliziertesten Bestandteil der Toilette bildet die Frisur, welche die größte Aufmerksamkeit erheischt und nur jeden dritten oder vierten Tag neuerdings hergestellt wird, weil die Konstruktion eines solchen Wunderwerkes, ganz ebenso wie bei den Frauen Chinas, enorme Mühe und einen Zeitaufwand von etwa zwei Stunden erfordert. Ich hatte begreiflicherweise nicht die Geduld, dem Werden eines kunstvollen Aufbaues vom Beginn bis zum Ende anzuwohnen, sondern begnügte mich mit der Erkenntnis, dass dem kühn aufstrebenden und nach rückwärts in koketten Linien ausladenden Arrangement eine Unzahl von Unterlagen aus Papiermache inneren Halt gewährt, sowie reichlich angewandte Pomaden und Öle äußere Glätte und Glanz verleihen.
Nadeln, Kämme, Blumen, Federn, Bänder und allerlei Flitter werden im Haar angebracht und tragen zur Gesamtwirkung wesentlich bei. Angeblich existieren an 60 verschiedene Arten von Frisuren, welche für den Wissenden sogar besondere Bedeutung haben, indem sie über Stand und Absichten der Trägerin Aufschluss geben, so dass Japans Frau, während in unseren Landen die Schönen nur durch Blumen und Fächer zu reden verstehen, auch eine „Haarsprache“ kennt. So soll eine Witwe, die nicht abgeneigt wäre, in einem neuen Bund ihr Glück zu suchen, das Haar in einer ganz bestimmten Form tragen, während eine Witwe, welche Hymen abgeschworen, dies durch eine einfache, offenbar Resignation ausdrückende Haartracht anzudeuten vermag. Dieser Verwendung der Frisur lässt sich praktische Bedeutung nicht absprechen, wie wenigstens diejenigen, welche auf Freiersfüßen wandeln, einräumen werden; denn es bedarf nur eines Blickes nach dem Haupt der Ersehnten, um das höher klopfende Herz darüber zu belehren, ob Erhörung zu hoffen ist oder nicht.
Von geradezu reizendem Effekt ist die nationale Tracht der Japanerinnen. Dieselbe besteht aus dem Kimono, einem bis auf die Knöchel herabreichenden, vorne etwas offenen Gewande mit weiten, bauschigen Ärmeln, welcher durch eine breite Schärpe, den Obi, die rückwärts zu einer großen Schleife geschlungen ist, zusammengehalten wird. Der Kimono schmiegt sich der Gestalt weich und zwanglos an, verleiht derselben etwas ungemein Graziöses und lässt sie in vorteilhaftester Weise zur Geltung kommen; allerdings aber glaube ich, dass eben nur die zierlichen, diskret modellierten Formen der japanischen Weiblichkeit sich für den Kimono eignen. Dieser ist übrigens auch das Kleidungsstück der Japaner, soweit letztere sich nicht schon europäischer Tracht bedienen, und wird nur kürzer sowie einfacher als jener der Frauen getragen. Der Obi der Männer stellt sich als wiederholt um die Lenden geschlungener Zeugstreifen dar, durch welchen die Samurais — die Vasallen des Schöguns, der als faktischer Herr des Landes die kaiserlichen Regierungsrechte ausübte, sowie der Daimios, der großen Feudalherren — früher zwei Schwerter steckten, während der Gürtel seit dem im Jahre 1876 ergangenen Verbote des Waffentragens nur mehr die friedlichere Bestimmung hat, neben dem Kleidungsstück selbst auch Fächer und Rauchrequisiten festzuhalten.
Anfänglich macht es auf den Europäer einen befremdenden Eindruck, die Kinder ebenso gekleidet zu sehen, wie die Erwachsenen, doch ist man an diesen Anblick bald gewöhnt und ergötzt sich an den putzigen, kleinen Menschen, die in ihren Gewändern mehr zu sein scheinen, als sie in der Tat sind. Da unter Japans Himmel die körperliche und geistige Entwicklung der Jugend sich offenbar sehr rasch vollzieht, sahen wir nicht wenige Kinder, die, ihres zarten Alters ungeachtet, überaus altkluge Mienen machten und sich so gesetzt benahmen, dass sie oft genug unsere lebhafteste Heiterkeit erregten.
Nagasaki, dessen Straßen wir mit wachsender, weil immer von neuem angeregter Schaulust durchzogen, ist vom höchsten historischen Interesse für den Europäer und für den Christen insbesondere. Noch immer eine der bedeutendsten Handelsstädte Japans, blühte Nagasaki aus einem ärmlichen Fischerdorf empor, nachdem um die Mitte des 16. Jahrhunderts der Daimio von Omura den Portugiesen gestattet hatte, sich daselbst anzusiedeln. Auf Kiuschiu schlug das Christentum seine tiefsten Wurzeln unter der eingeborenen Bevölkerung; hier hatte der Apostel Japans, ein Jünger Ignazens von Loyola, der heilige Franz Xaver, im Jahre 1549 in Kagoschima den Boden Nippons betreten. Innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit breitete sich das Christentum, begünstigt durch mannigfache Umstände, in überraschendem Maß aus; doch war vielleicht gerade dieser große Erfolg der nächste Anlass zu einer Reaktion, welche sich in immer blutigeren Verfolgungen äußerte, die auf Grund einer vom Schogun Ijejasu im Jahre 1614 erlassenen Proklamation im ganzen Land bald allgemein wurden. Durch diese Christenverfolgungen dürften jene im römischen Reich in den Schatten gestellt sein; denn Tausende und Tausende haben in bewundernswürdiger Standhaftigkeit ihre Glaubenstreue mit dem qualvollsten Tod besiegelt, und ruhmvolle Blutzeugen sind der Kirche in jenen fernen Weltteilen erstanden. Während jedoch die neubegründete Religion im römischen Reich aus den Blutbädern immer gekräftigter hervorgegangen ist, gelang es in Japan, die Lehre des Heiles durch das grausame Vorgehen wider ihre Bekenner auszurotten.
Im Jahre 1636 griffen endlich, durch die zwei Jahrzehnte dauernden Greuel zur Empörung getrieben, 30.000 bis 40.000 Christen des Fürstentumes Arima und anderer Gebiete der Insel Kiuschiu zu den Waffen, setzten sich in dem alten Schloss von Arima auf Schimbara sowie auf benachbarten Inseln in Verteidigungszustand und leisteten unter Nirada Schiro im Jahre 1637 dem zu ihrer Bekämpfung entsandten Itakura Schigemasa durch drei Monate heroischen Widerstand. Endlich aber ward die Feste bezwungen, und ihre tapferen Verteidiger wurden niedergemacht. Ströme Blutes flossen, Tausende gefangener Katholiken wurden nach der über 60 m aus dem Meere steil aufragenden, dem westlichen Hafeneingange Nagasakis vorgelagerten Insel Taka-boko geschleppt und von deren schwindelnder Höhe in den Ozean gestürzt. Die Holländer nannten diese Insel zum Gedächtnisse der schauerlichen Szenen, deren Schauplatz das Eiland gewesen, „Papenberg“, haben sich aber hiedurch, wenn die geschichtliche Überlieferung auf Wahrheit beruht, selbst kein ehrendes Denkmal gesetzt; denn durch den Hass gegen den Katholizismus und durch Handelsneid verblendet, sollen die Holländer den Schogun in seinem Kampf gegen die aufständischen Katholiken mit Waffengewalt unterstützt haben.
Dem Blutbad von Schimbara folgten die Vertreibung der Portugiesen, die nahezu gänzliche Unterdrückung des Christentums, das sich nur stellenweise und namentlich unweit Nagasakis in der großen Gemeinde Urakami bis in unsere Tage erhalten hat, und der Beginn jener Ära vollständigster Abschließung, durch welche Japan sich bis in die Neuzeit herein völlig isoliert hat. Die Chinesen und die Holländer unterhielten nahezu ausschließlich den Verkehr mit dem Westen und auch diesen nur in bescheidenem Umfange. Letztere mussten 1641 ihre Faktorei zu Hirado auflassen und sich auf Deschima (Vorinsel) ansiedeln, einer künstlichen Bodenantragung, die mit Mauer und Graben umgeben und mit Nagasaki durch eine steinerne Brücke verbunden war, deren Tor von einer japanischen Wache besetzt gehalten wurde. Derart in strengem Gewahrsam, um nicht zu sagen, in Gefangenschaft gehalten, vermittelten hier jeweils etwa 20 Holländer den Handel zwischen Japan und dem Mutterland, aus dem anfänglich jährlich nur ein Schiff, später aber deren acht zugelassen wurden.
Die Vorteile, welche aus diesem Handel geflossen sind, müssen in der Tat sehr bedeutende gewesen sein, um auch für all die wahrlich nicht geringen Demütigungen entsprechend zu entschädigen, denen die Holländer durch mehr als zwei Jahrhunderte unterworfen waren. So musste der Resident von Deschima alljährlich eine mit großen Kosten verbundene, unter strengster Bewachung erfolgende und nach genau geregeltem Zeremoniell sich vollziehende Reise nach Jedo (Yedo, Tokio) unternehmen, um dem Schogun Geschenke zu überbringen und Ehrerbietung dadurch zu bezeugen, dass er in einer feierlichen Audienz gegen den durch einen Vorhang verborgenen Schogun auf allen Vieren zukroch, das Haupt zu Boden senkte und wie ein Krebs wieder zurückschlich.
Bei einer darauf folgenden, minder feierlichen Vorstellung war es Aufgabe der holländischen Begleiter des Residenten, den Frauen und den übrigen Mitgliedern des Hofstaates zur Kurzweil zu dienen, indem jene auf Befehl des Schoguns singen, tanzen, Betrunkene vorstellen und derartiger Allotria mehr treiben mussten. Was doch der Homo sapiens um schnöden Mammons willen zu tun fähig ist! Das alte Deschima, der ewig denkwürdige Schauplatz blühenden Handelsgeistes und tiefer Erniedrigung, ist einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen und hat einer neuen Ansiedlung Platz gemacht — als hätte die in unserer Zeit erfolgte gewaltige Umwälzung der Verhältnisse sich auch auf die Vergangenheit erstrecken und durch Umgestaltung jener Stätte den Europäern die unrühmliche Mahnung an das alte Japan ersparen wollen!
Bei der Wanderung durch Nagasaki hielten wir oft genug inne, um unsere Blicke, soweit es das etwas günstiger gewordene Wetter gestattete, an der Szenerie zu weiden, welche der Hafen in seiner Umrahmung bietet und die uns schon bei der Einfahrt entzückt hatte. Die Bucht von Nagasaki wird, wie schon bemerkt, im Westen durch Taka-boko abgeschlossen, während die übrigen Seiten von Hügeln und bis zu 400 m sich erhebenden Bergen mit sanft ansteigenden Geländen umsäumt sind, so dass der Hafen ganz den Charakter eines lauschig verborgenen Gebirgssees an sich trägt. Diese Höhen weisen in ihren unteren Teilen Kulturen aller Arten und bald da, bald dort kleine Haine, Dörfer, Tempel und Häuschen auf; die höheren Partien sind zum Teil überaus malerisch mit Kiefern, Cryptomerien und Kampherbäumen bekleidet. Alle Töne der Farbenskala leuchten uns von den Gipfeln der Berge bis herab zu den bebauten, blumengeschmückten Gefilden und zu der bläulich schimmernden See entgegen, auf deren glattem Spiegel mächtige Kriegsschiffe und große Fahrzeuge friedlicher Bestimmung vor Anker liegen, zahlreiche Fischerboote dahinziehen und sich allerlei Barken tummeln.
Obwohl Nagasaki, welches 58.000 Einwohner zählt, kein produktives Hinterland wie die Städte Jokohama und Kobe hat, ist es dank seinem Hafen, in den Schiffe jeder Größe einlaufen können, noch immer eine bedeutende Handelsstadt, welche Schildpattarbeiten, Lack- und Tonwaren, ferner Steinkohle, Reis, Tee u. dgl. zur Ausfuhr bringt.
Dass vorzugsweise auf Ankäufe durch Fremde gerechnet wird, beweisen die zahllosen, die Straßen füllenden Läden, welche japanische Erzeugnisse aller Arten, namentlich solche, die wir als Kuriositäten zu betrachten gewohnt sind, bergen. Jene Läden, welche durch englische Aufschriften gekennzeichnet, also am fortschrittlichsten geartet sind, scheinen mir die geschmackvollsten und solidesten Artikel zu bieten; doch sind auch die exorbitanten Preise darnach, welche der Ladenbesitzer schmunzelnd ausspricht, um dann durch Ermäßigung im richtigen Augenblicke den kauflüstern gewordenen Fremdling zu weiteren Erwerbungen anzuspornen. Die Landschaft Kiuschiu, die gleichnamige Insel und deren Gebiet umfassend, ist der Sitz einer seit altersher berühmten Porzellan- und keramischen Industrie; daher sahen wir auch allenthalben Arita- oder Hisen-Porzellan, ferner Amakusa-Porzellan aus dem auf der Inselgruppe von Amakusa vorkommenden Porzellanstein und Satsuma-Steingut mit seiner farbenbunten und prächtigen Bemalung auf gelblichem Grunde, das zwar in Europa hochgeschätzt ist, meinem Geschmack aber nicht besonders entspricht.
Eine stattliche Reihe von Kaufläden hatten wir bereits abgelaufen und lenkten unsere Schritte nun einem der zahlreichen Teehäuser zu, welche hier die Stelle der Restaurants vertreten. Die Teehäuser sind überaus zierlich, beinahe filigranartig gebaut und enthalten eine Reihe von Räumen, welche jedoch infolge Verstellbarkeit der Wände nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden können, und offene Veranden. Hier finden sich die Gäste ein, nicht nur um die üblichen Erfrischungen, wie Tee, Sake, das ist Reiswein, der ähnlich wie Sherry schmeckt, u. dgl. m. zu schlürfen, sondern auch um vollständige Diners einzunehmen. Da hierzulande die Gepflogenheit herrscht, derartige Symposien durch die Produktionen von Sängerinnen und Tänzerinnen zu beleben, hatten auch wir Auftrag gegeben, solche Künstlerinnen, Geischas, welche nie im Teehaus, sondern außerhalb desselben wohnen und hieher berufen werden, kommen zu lassen.
Wir hatten uns in einer offenen Veranda auf weichen Matten kaum niedergelassen, als schon die Wirtin mit einer Schar von Kellnerinnen, — man pflegt sie mit dem Worte „Nesan“ zu rufen — Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren, erschien, um uns das Diner in einer Unzahl von Lackschächtelchen, Näpfchen, Tässchen und Tellerchen zu servieren. Obwohl die Küche begreiflicherweise nicht ganz nach unserem Geschmack war, fand ich die Gerichte doch viel appetitlicher als jene der chinesischen Kochkunst; Fische und Reis bildeten die Hauptbestandteile des Menüs, zu welchem wir anfänglich Reiswein tranken, bis ich das Vorhandensein von Bier entdeckte, worauf wir uns mit edlem Gerstensaft labten.
Während des Diners traten zuerst die Sängerinnen auf; es waren dies junge Mädchen, durchwegs gleich gekleidet und frisiert sowie stark geschminkt, welche sich unter zahllosen Verbeugungen uns zur Seite niederließen und zu den Klängen mandolinartiger Instrumente, Gekin und Biwa, die mit Klöppeln geschlagen wurden, einen Gesang anstimmten; dieser bewegte sich nur innerhalb weniger Töne und brachte eine ungemein monotone Wirkung hervor. Der Versuch, die Damen durch Genuss von Sake zu einem heiteren Lied oder wenigstens zu einem rascheren Tempo in ihrem Vortrag zu bewegen, schlug gänzlich fehl.
Äußerst zierlich und ansprechend war die Produktion der Tänzerinnen, welche choreographische Bewegungen in einer Weise zum besten gaben, dass wir die Gewandtheit und Beweglichkeit, hauptsächlich aber das erfolgreiche Streben, jede Figur in formvollendetster Weise zur Ausführung zu bringen, nicht genug bewundern konnten. Obschon die Künstlerinnen aus der Schule von Tanzmeistern hervorgehen, ist es doch unverkennbar die natürliche, im Wesen des japanischen Volkes liegende Grazie, welche die Tänzerinnen auszeichnet; denn die Art, wie sie vor- und rückwärtsschreiten, sich drehen und wenden, sich senken und heben, den Fächer halten und bewegen, ihre Gewandung in Falten schlagen und mit dem langen Ärmel spielen — dies alles atmet die vollkommenste Anmut. Stunde auf Stunde vermögen die Japaner, ruhig auf den Matten hockend und Tee schlürfend, dieses Schauspiel zu genießen; ich hätte bei aller Anerkennung, die ich den Künstlerinnen zolle, nicht die Geduld, mich ebenso lange an derartigen Produktionen zu weiden, die zwar sehr interessant sind, aber namentlich für einen Fremden und mit der Sache nicht völlig Vertrauten auf die Dauer eintönig werden. Die Tänze sollen bestimmte Handlungen veranschaulichen, die uns natürlich ganz unverständlich blieben.
Am Schluss der Vorstellung wurde noch eine Koryphäe vorgeführt, ein Mädchen im Alter von 13 Jahren, die Prima Ballerina des Viertels und der Stolz ihres Tanzmeisters; diese Künstlerin produzierte eine Reihe von schwierigen Tänzen und Evolutionen unter Zuhilfenahme von Masken, Blumen u. dgl. m. in wirklich vortrefflicher Art. Ein in unserer Gesellschaft befindlicher Japaner war ganz entzückt und lächelte glückselig angesichts so vollendeter Kunstleistung; ich aber konnte mich in einer übrigens den Verhältnissen Japans vielleicht nicht genügend Rechnung tragenden, heimatlichen Anwandlung des Widerstrebens nicht entschlagen, das ich gegen jede wie immer geartete Schaustellung von Kindern empfinde.
Von der Veranda des Teehauses genossen wir einen lohnenden Blick auf Nagasakis Umgebung sowie auf die Stadt selbst. Farbenbunten Bändern gleich ziehen sich in dieser die kleinen Hausgärten, zum Teile wahre Miniaturanlagen, hin, welche innerhalb sehr enge gesteckter Grenzen allerlei Zierrat, ferner blühende Blumen in großer Zahl und barock verschnittene Bäumchen bergen.
In den engen Straßen der Stadt rollen flüchtige Dschinrickschas auf und nieder. Ich vertraute mich, nachdem wir die verschiedenartigen kulinarischen und künstlerischen Genüsse, welche uns das Teehaus geboten, zur Genüge durchgekostet hatten, einem jener Vehikel an und unternahm so noch eine Spazierfahrt durch die Stadt, um dann am vorgerückten Abend an Bord zurückzukehren, wo es galt, noch die Vorbereitungen für die Ausschiffung und die Reise durch das Land zu treffen.
Während ich in der Stadt weilte, hatte mir der Gouverneur eine Anzahl von Photographien, welche teils Partien Nagasakis und seiner Umgebung, teils allerlei Szenen und Typen darstellten, sowie ein Paar allerliebster Zwerghühner an Bord gesandt — eine Aufmerksamkeit, für die ich dem liebenswürdigen Spender Dank weiß.
Links
- Ort: Nagasaki, Japan
- ANNO – am 03.08.1893 in Österreichs Presse.
- Das k.u.k. Hof-Burgtheater macht Sommerpause bis zum 15. September, während das k.u.k. Hof-Operntheater die Oper „Das goldene Kreuz“ aufführt.