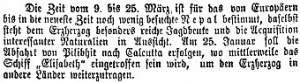So fuhren wir denn auf kühnem Gebilde von Menschenhand dem Himalaya, dem höchsten Gebirge der Erde zu! Durch elementare Revolutionen entstanden, in schier unerreichbaren Spitzen dem Himmel entgegenstrebend, erhebt sich der Himalaya, das „Schneeheim“, der
kolossale Bergwall, welcher die Arier von den Mongolen, Indien von Innerasien trennt. Nie hat ein Feind ihn überschritten, nur scheu hat er ihn umgangen. Über 24 Längengrade sich erstreckend, vom Hindukusch bis zum Durchbruch des Brahmaputra reichend, steht der Himalaya mit dem Nordfuße auf den öden Plateaus von Tibet, mit dem Südfuß auf
der vorderindischen Tiefebene, als eine Grenzscheide des Klimas, der Pflanzen- und Tierwelt, der Völker und der Kultur zwischen Innerasien und Südasien.
Durch die ihm vorliegende Talmulde nähern wir uns seiner Region; erheben uns zu seiner südlichen Vorkette, die auf blühende, grünende, üppige, von herrlicher Luft umfächelte Waldberge herabsieht; blicken nach den Gipfeln der Zentralkette, jenseits deren nördlicher Vorkette wildes, kahles, zackiges Höhenland liegt. Über die diese Talmulde nördlich begrenzenden, von dunklem Waldesgrün bedeckten Vorberge windet sich die Bahn bis Dardschiling empor, bis zum Fuß der größten Gletschergruppen der Erde, bis in das Gebiet hinein, in dem der Dhaulagiri (8176 m), der Kantschindschinga (8585 m) und jener höchste Gipfel der Erde thronen, den wir Mount Everest (8840 m) oder Gaurisankar nennen hören. Der Kantschindschinga, — »die fünf weißen Brüder« — dessen von ewigem Schnee bedeckte, von Gletschern durchfurchte, aus dichtem Wald aufsteigende Riesenkette wir hier zu schauen gekommen sind, liegt in Sikkim, jenem kleinen Schutzstaat, der wie ein Keil zwischen Nepal und Bhutan sich einschiebt und durch die kühne, in Dardschiling endigende Bergbahn mit den Schienensträngen der Ganges-Ebene verbunden ist.
Von der Hoffnung beseelt, den Zauber dieser unsäglich schönen und großartigen Gebirgswelt in voller Pracht bewundern zu können, lugte ich lange vor Sonnenaufgang aus meinem Fenster, um das Wetter zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen, ob wir einen reinen, nebelfreien Tag haben würden oder nicht. Obgleich der Morgen heiter war und der Sonnenaufgang schön zu werden versprach, entdeckte ich doch im Westen kleine, längliche Wolkenstreifen, die in unseren heimatlichen Bergen von allen erfahrenen Wetterpropheten als ungünstiges Omen gedeutet werden, weil sie zumeist Regen oder Nebel prophezeien. Leider hatte sich dieses untrügliche Zeichen auch hier bewahrheitet; als wir an den Fuß der Vorberge gelangten, sahen wir die Spitzen bereits in Nebel gehüllt.
Nach 7 Uhr morgens waren wir von Siliguri abgefahren. Die Bergbahn Siliguri—Dardschiling, die eine Länge von 82 km besitzt und in eine Höhe von 2180 m steigt, ist wohl die interessanteste Bahn der Welt; nicht so sehr, was ihren Bau und ihre Anlage anbelangt, als wegen der unvergleichlichen Panoramen und Bilder, deren Anblick sie bietet. Die Bahn hat eine Spurweite von nur 61 cm, besitzt, um freien Ausblick zu gewähren, offene Waggons und kann unbedingt als ein kühnes und ganz eigenartiges Werk bezeichnet werden. Man bedenke nur: eine Bergbahn, die ohne Tunnel eine so bedeutende Höhe erklimmt und im ganzen — nach der Angabe des Chef-Ingenieurs — nur 231.000 fl. ö. W. gekostet hat! Das Rätsel erklärt sich teilweise dadurch, dass die Bahn bloß auf einer Schienenlänge von 24 km die Herstellung eines besonderen Bahnkörpers erfordert hat, während sie die übrige Strecke hindurch die bereits vorhandene Gebirgsstraße benützt, um sich emporzuwinden. In den schärfsten Kurven und Windungen geht es bergauf; die Bahn steigt in solchen Serpentinen und Krümmungen, dass an vielen Stellen das Geleise, welches in den nächsten Minuten befahren werden soll, schon einige Meter hoch über dem Zuge sichtbar wird. Wo scharfe Kurven und Serpentinen nicht mehr genügt hätten, um eine steile Höhe zu erklimmen, ist dadurch Rat geschafft, dass der Zug eine Strecke geradeaus emporfährt, um dann in einem scharfen Winkel in entgegengesetzter Richtung, mit schiebender Maschine, höher aufzusteigen, so dass man im Zick-Zack aufwärts kommt.
Aber was sind alle diese Künste der Technik gegen die Pracht und Mannigfaltigkeit der Natur! In der grünen Steiermark geboren und die Berge über alles liebend, war es immer mein heißer Wunsch gewesen, den König aller Gebirge, den Himalaya, zu sehen und die tropische Welt der Berge kennen zu lernen. Wie viel ich auch über die großartige Schönheit des Himalaya gehört und gelesen — was ich nun sah, übertraf alle meine Erwartungen und versetzte mich in unbeschreibliches Entzücken. Schon die leichte, reine Gebirgsluft wirkte herrlich erfrischend — was Wunder, dass wir alle nach und nach im Waggon zu jodeln begannen, als wären wir in den oberösterreichischen Bergen. Obgleich leider der Nebel sämtliche Spitzen in undurchdringliche Schleier gehüllt und auch die Fernsicht getrübt hatte, war doch das, was wir in der Nähe zu sehen bekamen, genug, um diese Fahrt zu einer unvergesslichen zu machen.
Die landschaftlichen Reize ringsum sind wahrhaft entzückend: ein Gebirge von weit mehr als 8000 m Elevation, bis zur Höhe von 3000 tn mit tropischer Vegetation bedeckt, mächtige Gebirgsrücken, tief eingeschnittene Täler, überhängende Felsen, schroffe Lehnen, steile Abhänge, unermessliche Abgründe — alles grün in grün oder verschwimmend in zarten violetten Tinten. Und welch ein Pflanzenkleid umgürtet den Südrand des Himalaya! Die Vegetation gemahnt an jene Ceylons; aber noch höher und schöner als die Baumriesen Ceylons streben hier die Stämme mit ihren üppigen Blätterkronen empor; noch dichter und wilder schlingt sich hier das Pflanzenwerk um Stamm und Äste. Die Bäume sind bis zu den höchsten Zweigen hinauf mit Farnen, Orchideen und anderen Schmarotzerpflanzen bedeckt, während dicke Lianen die Stämme untereinander verbinden, und selbst die schroffsten Lehnen, die wildesten Abstürze sind mit einem grünen Teppiche dicht aneinander stehender Bäume und Sträucher überzogen. Bei jeder Biegung, jeder Serpentine fesselt uns ein neues Bild; besonders die vielen, tausend Meter tiefen Abgründe, an denen man auf Schuhbreite vorbeifährt, bringen reichen Wechsel in das Panorama.
Die der Charakter des Landes, so hat sich auch die Bevölkerung geändert — wir sind ja in Sikkim, an der Grenze Tibets und Chinas. Hier, in Sikkim, hausen Volksstämme, die, wiewohl mit indischem Blut vermischt und von indischer Kultur beeinflusst, doch im Typus und in der Sprache den Tibetanern nahestehen. Die Leptschas, welche Sikkim und auch Dardschiling bewohnen, gehören unzweifelhaft, trotz manchen arischen Einschlags zu den Halbkulturvölkern der mongolischen Rasse. Innerasiatisches Gepräge haben hier die Bewohner der kleinen, zerstreut liegenden Bergdörfer; reinen mongolischen Typus die Tibetaner, die als Händler oder Arbeiter vom Norden hieher einwandern. Der Typus der Leptschas ist grundverschieden von jenem der bisher gesehenen Völkerschaften; auf den ersten Blick erkennt man die Merkmale der mongolischen Rasse: die gelblichbraune Haut, das breite Gesicht, die kleinen, schief geschnittenen Augen, die stark hervortretenden Backenknochen, den niederen Wuchs, das grobe Haar, den spärlichen Bartwuchs. Sowohl Männer als Weiber sind äußerst hässlich; bei letzteren herrscht die eigentümliche Sitte, sich im Winter, als Schutz gegen die Kälte, das Gesicht mit Ochsenblut einzuschmieren, was ihnen ein besonders abstoßendes Aussehen verleiht. Am ärgsten richten sich aber die Witwen zu, die sich zum Zeichen der Trauer die Nasen ganz schwarz färben.
Die Kleidung der Männer besteht aus einem farbigen, langen Kaftan, der durch einen breiten Gürtel, in dem sich die Waffen befinden, festgehalten wird; hiezu kommen oben weite, unten sich verengende Hosen und hohe, aus einem Stück geschnittene, farbige Stiefel oder Schnabelschuhe. Auf dem Kopf tragen die Leptschas Pelzmützen oder schon stark an chinesische Kopfbedeckungen erinnernde Mützen. Der Hals wird durch Silbergeschmeide, kleine Türkis-Amulette oder Korallenbänder geziert. Manche Männer bedienen sich statt des Kaftans einer Art Hemdes und darüber eines offenen Rockes aus dickem Lodenstoff. Die Weiber haben weite, faltige Kleider sowie Gürtel und scheinen Geschmeide sehr zu lieben, da sich selbst die ärmsten mit Ketten. Amuletten und vor allem mit langen Ohrgehängen von Türkisen schmücken; manchmal tragen sie auch auf dem Kopfe einen aufrecht stehenden Reif aus Türkisen und Korallen. Der Zopf, welcher beide Geschlechter schmückt, sowie die Finger werden mit Ringen geziert.
Während der Fahrt kamen wir an kleinen Ansiedelungen knapp vorbei; ja wir streiften beinahe die Häuser mit den Waggons und hatten dabei oft Gelegenheit, Einblick in das häusliche Leben der auf einer noch sehr primitiven Kulturstufe befindlichen Leptschas zu gewinnen. Abschreckenden Eindruck macht bei diesen Beobachtungen der scheußliche Schmutz, der überall herrscht. Merkwürdig ist die hier, übliche Art, das Lebensalter zu bestimmen: die Leptschas berechnen nämlich ihr Alter nach der Anzahl der abgetragenen Kleider, so dass man auf Befragen die Antwort erhält: »Dieser oder jener ist sieben Kleider alt.«
Von Zeit zu Zeit wird in Stationen Halt gemacht, damit die Lokomotive Wasser nehmen könne. Diese Momente benützen die Eingeborenen, um sich an die Wagen heranzudrängen und manche schöne Waffe, besonders haarscharf geschliffene Messer feilzubieten.
In der Höhe von 1525 m befindet sich eine Filiale des Jesuiten-Kollegiums von St. Xaver in Calcutta. Dann geht es immer höher und endlich kommen wir sogar an einzelnen kleinen Schneeflächen vorbei, den Spuren des letzten starken Schneefalles.
Je höher wir kamen, desto empfindlicher wurde die Kälte und desto dichter leider auch der Nebel, so dass die Rundsicht sich immer beschränkter gestaltete. Von den Bergesspitzen sah man gar nichts mehr, und auch in den Tälern begannen die Nebel zu wogen. So hatte ich denn Muße, mich mit den näher gelegenen Dingen zu beschäftigen, mir die Flora genauer zu besehen. Die mächtigen Baumriesen mit ihren Luftwurzeln entzückten mich nicht minder als die mannigfaltige Abwechslung in den Farnen, deren es alle Arten, vom mächtigen Baumfarn, der hier in großer Menge vorkommt, angefangen, bis zu einem kleinen, dem Frauenhaar ähnlichen Farne gibt. Bisher hatte ich die Baumfarne nur als verkrüppelte Exemplare in unseren Warmhäusern gesehen; jetzt konnte ich mich in einer Höhe von über 2000 m an Tausenden dieser herrlichen Pflanzen erfreuen.
In den höheren Lagen wird die Schönheit der Gegend wesentlich durch die vielen Teeplantagen beeinträchtigt; denn überall, selbst an den steilsten Lehnen und an schroffen Rissen hat die kultivierende, nach Gewinn strebende Hand des Menschen den herrlichen Urwald zerstört und durch den Reihenbau des Teestrauches das Panorama ernüchtert. Gegen die uralten, vielhundertjährigen Stämme wird barbarisch gewütet; denn Holz hat hier so wenig Wert, dass man sich zur Gewinnung von Kulturboden eines einfachen Mittels bedient, indem der Holzwuchs auf Tausenden von Hektaren einfach niedergebrannt wird. Die Prosa des wirtschaftlichen Lebens lässt sich selbst von der Poesie der bezauberndsten Vegetation keine Gesetze vorschreiben. Dass die Zerstörung des dem Tod geweihten Waldes in summarischer,
möglichst billiger Weise vorgenommen wird, ist begreiflich, doch kann planlose Verwüstung schwere Gefahren nach sich ziehen; der Wald rächt die ihm gewordene Missachtung.
Schmerzliche Empfindung beschleicht den Waldfreund, wenn er die Rauchsäulen des Feuers aufsteigen sieht, welches Bestandteile einer urwüchsigen Natur vernichtet — sei es auch, um Boden für die Kultur der Teepflanze zu gewinnen. Wie groß übrigens deren wirtschaftliche Bedeutung sein mag, diese kann auch das nicht entschuldigen, dass der Tee Veranlassung oder Vorwand zu zahllosen Soireen und Afternoon-teas geworden ist
Nach 10 Uhr vormittags erreichten wir die Station Kurseong, wo das Hotel Clarendon festlichen Schmuck angelegt hatte, und langten um 1 Uhr in Dardschiling, in tibetanischer Sprache „Heiliger Ort“, an. Hier erwarteten uns der Deputy Commissioner Mr. Waller und Major Ommaney, sowie eine große Menschenmenge, aus Europäern und Eingeborenen bestehend.
Dardschiling, gegründet 1835, ist jetzt der Hauptort des gleichnamigen Distriktes (3196 km2), welchen die Engländer gegen eine Jahresrente von etwa 3750 fl. ö. W. von dem Schutzstaat Sikkim, dessen Radscha in Tamlung residiert, abgetrennt haben.
Infolge seiner hohen Lage und seines herrlichen Klimas ist Dardschiling der beliebteste Sommeraufenthalt in Indien. Von der Milde des Klimas, welches jenem Merans ungefähr gleichkommt, liefert der Umstand Zeugnis, dass in diesem gesegneten Landstrich die Teekultur noch bis zu 2000 m empor, der Obstbau noch in der Höhe von nahezu 3000 m und der Getreidebau noch über 3000 m hinaus möglich ist. Das Städtchen besteht außer einem kleinen Eingeborenen-Viertel mit reichem Bazar größtenteils aus Villen, Hotels und öffentlichen Gebäuden, besonders Sanatorien und Spitälern, die im Sommer von Europäern, vornehmlich aus Calcutta, überfüllt sind. An einem Abhange des Dschillapatar, eines Kammes der Hauptkette des Himalaya gelegen, blickt Dardschiling gegen Norden auf den Gebirgsstock des Kantschindschinga, während in den anderen Weltgegenden das Auge über die zahllosen Bergrücken, Kuppen und grünen Täler des mächtigen Gebirges schweift. Hin und wieder lugte nach unserer Ankunft die Sonne hervor und beleuchtete für Augenblicke die Häuser von Dardschiling; die Berge aber blieben in undurchdringliche Wolken gehüllt.
Wir richteten uns zunächst im Woodlands Hotel häuslich ein und begannen sodann einen Rundgang in dem Bazar, der zur reichen ethnographischen Fundgrube für mich wurde. Hier waren interessante Waffen aufgespeichert; Messer, mit denen man jede Rupie auf einen einzigen Hieb durchschneiden kann; merkwürdige Sonnenuhren auf einem Stock dargestellt; zahlreiche Götterfiguren in Bronze; originelle Schmuckgegenstände; endlich verschiedene Musikinstrumente und Trommeln, darunter solche aus Menschenschädeln, sowie Pfeifen aus menschlichen Schenkelknochen. Die Trommeln bestehen aus zwei verkehrt aneinander gestellten Schädeln, deren untere Partien weggeschnitten und durch ein Fell ersetzt sind, welches durch einen mit metallischem Knopf versehenen Schlägel zum Tönen gebracht wird. Die Schädel sollen von Ehebrechern herrühren, die in Tibet zum Tod verurteilt wurden und deren Köpfe dann diese instrumentale Verwendung finden. Abschreckungstheorie in drastischem Ausdruck! Bei einem deutschen Händler fand ich auch wertvolle Sammlungen von Schmetterlingen und Vogelbälgen, die ich für mein Museum acquirierte. Dardschiling ist, was Schmetterlinge und Käfer anbelangt, der ergiebigste Fundort in ganz Indien; die Mannigfaltigkeit und die Farbenpracht der einzelnen Exemplare ist geradezu wunderbar.
Unsere Hoffnung, dass uns ein, wenn auch nur momentaner Ausblick auf die Berge beschieden sein würde, verwirklichte sich leider nicht; der Nebel blieb unerbittlich liegen.
Abends, nach dem Diner, welches wir frierend in einem luftigen Glassalon des Hotels einnahmen, überraschte uns Mr. Waller mit einem tibetanischen Tanz, der auf einem freien Platz aufgeführt wurde, obschon sich heftiger Regen in Strömen ergoss, ohne dass hiedurch der Feuereifer der tanzenden Künstler abgekühlt worden wäre. Die begleitende Musik ähnelte in ihrer Eintönigkeit, bei ausgiebiger Verwendung von Pauken und Tschinellen, sehr der indischen Musik; dagegen war der Tanz viel bewegter, ja geradezu wild und so dem Charakter der unbotmäßigen Gebirgsstämme angepasst. Namentlich die Damen waren in ihren Bewegungen sehr lebhaft und begleiteten den Tanz mit einem geheulartigen Gesange, der wie Kriegsgeschrei klang. Männer und Weiber tanzten nicht miteinander, sondern nach dem Geschlecht gesondert. Der Tanz stellte unter anderem auch Kämpfe mit wilden Tieren dar. Zwei Männer, die fratzenhafte, jenen unserer Clowns ähnliche Masken trugen, stürzten sich als »wilde Tiere« auf einen der Tanzenden und begannen sich mit diesem zu balgen, was schließlich in einen Wechselreigen der »Ungeheuer« mit dem Tänzer überging. Drachen, Löwen und Riesenvögel wurden von den Künstlern recht drastisch zur Anschauung gebracht.
Links
- Ort: Darjeeling, Indien
- ANNO – am 06.02.1893 in Österreichs Presse. Die Neue Freie Presse fasst Franz Ferdinands Indienreise bis jetzt zusammen und liefert einen Ausblick auf den Besuch in Nepal im März.
- Das k.u.k. Hof-Burgtheater zeigt das Lustspiel “Der Störefried”, während das k.u.k. Hof-Opermtheater das Ballet “Ein Tanzmärchen” aufführt.